Digitale Sackgassen: Warum Nürnberg immer noch unter langsamen Anschlüssen leidet
- Kevin Kienle

- 19. Nov. 2025
- 5 Min. Lesezeit
Ein Funkloch zwischen Grabsteinen
Es ist einer dieser absurden Momente, die viel erzählen: Am Westfriedhof, wenige Minuten vom Altstadtring entfernt, beugt sich eine junge Frau über das Grab ihres Großvaters, will ihrem Bruder ein Foto schicken – und starrt auf das Display: „Kein Netz“. Der Friedhofsweg ist voll, es ist Samstag, aber digital herrscht Funkstille.
Was wie eine Anekdote klingt, ist in Nürnberg kein Einzelfall. Wer in manchen U-Bahn-Stationen, Hinterhöfen oder an den Rändern der Stadt, aber auch teils mitten im Zentrum telefonieren oder arbeiten will, kennt die Mischung aus Frust und Resignation. Während Politik und Telekommunikationskonzerne von „Gigabitgesellschaft“ sprechen, fühlt sich der Alltag vieler Menschen in Nürnberg eher nach digitaler Provinz an.
Wo Nürnberg digital tatsächlich steht
Schaut man auf die offiziellen Karten von Bund und Land, sieht die Lage zunächst rosig aus: Der Breitbandatlas des Bundes zeigt für Nürnberg eine nahezu flächendeckende Versorgung mit Anschlüssen von mindestens 50 Mbit/s, in großen Teilen sogar 1 Gbit/s – zumindest theoretisch.
Entscheidend ist aber nicht nur, was technisch irgendwo im Straßenzug möglich wäre, sondern was real ankommt – und mit welcher Technologie. In Nürnberg sind laut einer Auswertung des Portals fiberfone aktuell rund 28 bis 29 Prozent der Haushalte mit echter Glasfaser versorgt, also mit Leitungen, die bis ins Gebäude oder in die Wohnung reichen. Das ist für eine deutsche Großstadt kein Totalausfall, aber eben auch weit entfernt von einem flächendeckenden Standard.
Gleichzeitig wirbt die Deutsche Telekom damit, dass in Nürnberg „bis zu 158.800 Haushalte“ an ihr Glasfasernetz angeschlossen werden können. Hinzu kommen andere Anbieter wie 1&1, die eigene Ausbauprojekte vorantreiben. Die Stadt selbst spricht davon, dass die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau mittlerweile in die „Zehntausende von Einzelmaßnahmen“ gehen – ein deutlicher Hinweis darauf, wie kleinteilig und langwierig der Prozess ist.
Die Diskrepanz: Auf der Karte wirkt Nürnberg bereits dicht vernetzt. Auf dem Sofa, in der WG oder am Küchentisch kommt davon oft nur ein Teil an – vor allem, wenn noch alte Kupferleitungen, instabile Kabelanschlüsse oder überlastete Funkzellen im Spiel sind.
Der Blick über den Tellerrand: Wie andere Städte vorlegen
Noch deutlicher wird das Problem im Vergleich: München etwa hat in den vergangenen Jahren massiv auf Glasfaser gesetzt – oft über den regionalen Anbieter M-net und in Kooperation mit der Stadt. Laut Unternehmensangaben sind dort inzwischen rund 640.000 Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen, was etwa 70 Prozent der Stadtbevölkerung entspricht.
Deutschlandweit ist der Trend grundsätzlich positiv: Laut aktueller BREKO-Marktstudie liegt die Glasfaserversorgung (Homes Passed) im Sommer 2025 bei etwa 53 Prozent der Haushalte, davon nutzen rund 27 Prozent den Anschluss tatsächlich. Das politische Ausbauziel von mindestens 50 Prozent bis Ende 2025 wird damit übertroffen – aber der Weg zu einer wirklich flächendeckenden Versorgung bleibt weit.
Vor diesem Hintergrund wirkt Nürnberg ambivalent: Die Stadt ist nicht Schlusslicht, sie profitiert von bundesweiten Ausbauprogrammen und Investitionen der großen Anbieter. Gleichzeitig ist sie weit entfernt von den Vorreiter-Städten, in denen Glasfaser bereits als weitgehend selbstverständlicher Standard gilt.
Funklöcher trotz 99-Prozent-Statistik
Ähnlich widersprüchlich ist das Bild beim Mobilfunk. Offiziell sind in Deutschland 4G- und 5G-Netze für fast alle Haushalte verfügbar, Bayern liegt in vielen Kennzahlen gut. Trotzdem zeigt ein Monitoring des Bundes: In Bayern gibt es weiterhin tausende Haushalte ohne LTE oder 5G, und die Mehrzahl der „weißen Flecken“ liegt in süddeutschen Flächenländern – Bayern inklusive.
Karten von Messportalen wie nPerf zeigen: In Nürnberg ist die Mobilfunkabdeckung entlang der Hauptachsen ordentlich, an manchen Rändern der Stadt, in Unterführungen oder eben auf Arealen wie dem Westfriedhof reißen Signale je nach Anbieter immer wieder ab. Das ist kein Münchner „Bergdorf-Problem“, sondern ein typisches Großstadtthema: dort, wo Topografie, Bebauung und wirtschaftliche Prioritäten der Netzbetreiber ungünstig zusammentreffen, entstehen kleine digitale Löcher mitten im urbanen Alltag.
Warum es trotz Förderprogrammen langsam geht
Man kann Nürnberg nicht vorwerfen, untätig zu sein. Bayern unterstützt seine Kommunen seit Jahren mit Beratungsprogrammen und Fördergeldern für den Breitbandausbau; das Bayerische Breitbandzentrum begleitet Städte und Gemeinden bei der Planung und Ausschreibung.
Auf Bundesebene wiederum setzen Marktstudien und gesetzliche Ziele den Rahmen: Bis 2030 sollte Glasfaser eigentlich überall verfügbar sein – doch der Branchenverband BREKO warnt, dass dieses Ziel ohne „klare politische Kurskorrektur“ kaum noch zu erreichen ist.
Die Gründe dafür lassen sich auch in Nürnberg beobachten:
Komplexe Genehmigungsverfahren: Jeder Straßenzug, jede Querung, jede Bohrung muss mit Stadt, Versorgern und teils mit Denkmalschutzbehörden abgestimmt werden.
Kapazitätsengpässe im Tiefbau: Es fehlt nicht nur Geld, sondern auch Bagger, Planerinnen und Baufirmen.
Zersplitterter Ausbau: Verschiedene Anbieter planen parallel, manchmal sogar konkurrierend. Der sogenannte „Überbau“, bei dem Konkurrenten Straßen ein zweites Mal öffnen, um eigene Netze zu verlegen, führt zu Verzögerungen und Akzeptanzproblemen.
Zurückhaltende Nachfrage: Viele Haushalte bleiben bei bestehenden DSL- oder Kabelverträgen, selbst wenn Glasfaser verfügbar wäre – auch, weil die Tarife teurer und die Vorteile nicht immer transparent sind.
Städte wie Nürnberg sitzen damit in der Zwickmühle: Sie sind auf private Investoren angewiesen, sollen gleichzeitig aber einen flächendeckenden, bezahlbaren und wettbewerblichen Netzausbau sicherstellen.
Was Kommunalpolitik konkret leisten kann
Trotz begrenzter eigener Finanzmittel hat Kommunalpolitik mehr Einfluss, als es auf den ersten Blick scheint. Beispiele aus anderen Regionen und Empfehlungen von Fachverbänden zeigen, welche Hebel Städte nutzen können:
Aktive Rolle der Stadtwerke und kommunaler Unternehmen: Studien des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) zeigen, dass Stadtwerke in vielen Regionen zu wichtigen Treibern des Glasfaserausbaus geworden sind – oft mit langfristiger Perspektive und eigenwirtschaftlichen Investitionen. Für Nürnberg stellt sich die Frage, ob kommunale Akteure noch stärker als Netzbetreiber, Mitinvestoren oder Infrastrukturdienstleister auftreten sollten.
„Dig once“ statt Dauer-Baustelle: Jede eröffnete Straße ist eine Chance: Städte können verbindlich festlegen, dass bei größeren Tiefbaumaßnahmen Leerrohre für spätere Glasfaser-Nutzung mitverlegt werden – unabhängig davon, welcher Anbieter aktuell baut. Leitfäden etwa des Landes Hessen zeigen, wie Kommunen solche Prozesse koordinieren und den eigenwirtschaftlichen Ausbau gezielt unterstützen können.
Transparente Ausbaupläne und Open-Access-Strategien: Wenn sich mehrere Anbieter um lukrative Stadtviertel kümmern, drohen Überbau und Insel-Lösungen. Kommunen können frühzeitig Runden mit Netzbetreibern, Wohnungswirtschaft und Versorgern einberufen und klar machen: Ein physisch einmal verlegtes Netz wird perspektivisch von mehreren Anbietern genutzt. Solche Open-Access-Modelle sind inzwischen in vielen Regionen etabliert und erleichtern Wettbewerb bei gleichzeitig effizienter Infrastruktur.
Beschleunigte Genehmigungen – mit klaren Qualitätsstandards: Bund und Länder drängen auf vereinfachte Verfahren, etwa Anzeige- statt förmlicher Genehmigung für standardisierte Bauweisen. Kommunen können darauf reagieren, indem sie digitale Antragswege, feste Bearbeitungsfristen und standardisierte Bauprofile einführen – ohne auf Qualitätskontrolle zu verzichten.
Soziale Perspektive mitdenken: Glasfaser im Neubauviertel ist das eine, erschwingliche Anschlüsse in Bestandsvierteln das andere. Kommunen können in Kooperation mit Wohnungsunternehmen und Anbietern Sozialtarife oder Stadtteilprojekte unterstützen, um zu verhindern, dass sich eine digitale Spaltung nach Einkommen und Quartier vertieft.
Alltag, Wirtschaft, Standort: Was auf dem Spiel steht
Für viele Nürnbergerinnen und Nürnberger ist langsames Internet nicht nur lästig, sondern ein Standortfaktor: Wer hybrid arbeitet, braucht stabile Videokonferenzen. Wer Unternehmen führt, braucht verlässliche Upload-Raten, Cloud-Zugänge und Datensicherheit. Und wer schlicht streamen, lernen oder Behördenkontakte online erledigen möchte, ist auf eine Infrastruktur angewiesen, die nicht beim Nachbarn endet.
Gleichzeitig konkurriert Nürnberg als Metropole der Metropolregion mit Städten wie München, Stuttgart oder Leipzig um Fachkräfte, Start-ups und Investitionen. In Rankings zur digitalen Standortqualität spielen Glasfaser- und 5G-Versorgung eine wachsende Rolle – nicht als Symbol für „Technikbegeisterung“, sondern als Grundbedingung moderner Arbeits- und Lebensformen.
Vom Funkloch zum Versprechen
Der Westfriedhof wird nicht das wichtigste Ausbaugebiet Nürnbergs sein. Aber er ist ein Sinnbild für eine Stadt, die sich zwischen Fortschritt und Rückstand bewegt: Glasfaser-Baustellen an jeder Ecke, Werbeplakate mit Gigabit-Versprechen – und gleichzeitig noch zu viele Orte, an denen das Netz brüchig bleibt.
Ob Nürnberg seine digitalen Sackgassen überwindet, entscheidet sich weniger an der nächsten Marketingkampagne eines Providers als an der Frage, wie Stadtverwaltung, Stadtwerke, Wohnungswirtschaft und Netzbetreiber zusammenarbeiten. Kommunalpolitik kann diesen Rahmen setzen – mit klaren Ausbauzielen, koordinierter Planung und der Botschaft, dass schnelles Internet keine Luxusoption ist, sondern Teil kommunaler Daseinsvorsorge.
Bis dahin bleibt der Moment am Westfriedhof eine Mahnung: In einer Stadt, die sich gerne als Innovationsstandort versteht, sollte der Empfang nicht gerade dort abreißen, wo Menschen innehalten, um sich an ihre Vergangenheit zu erinnern.


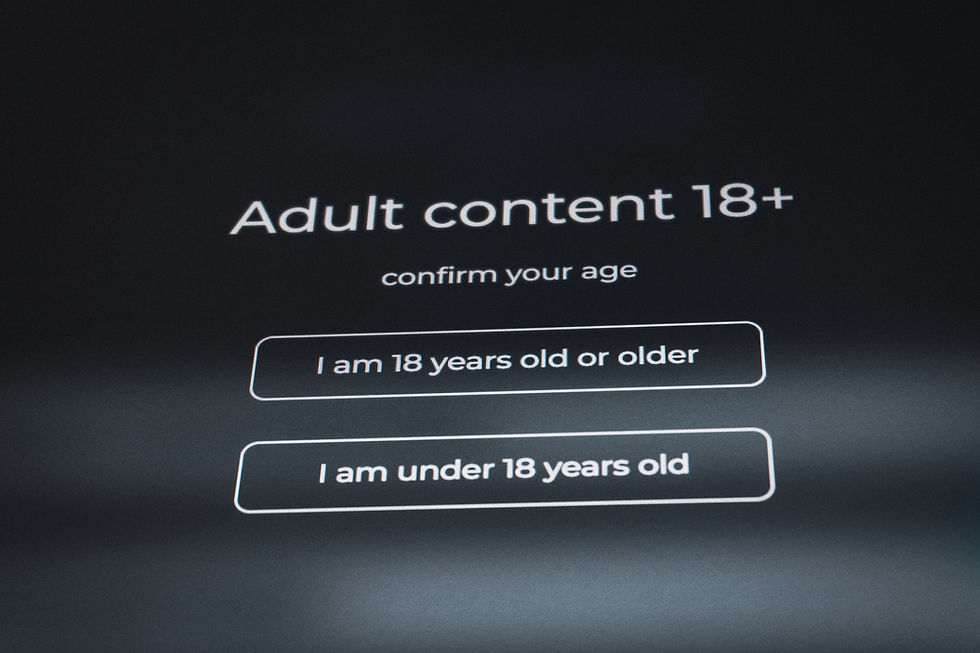

Kommentare